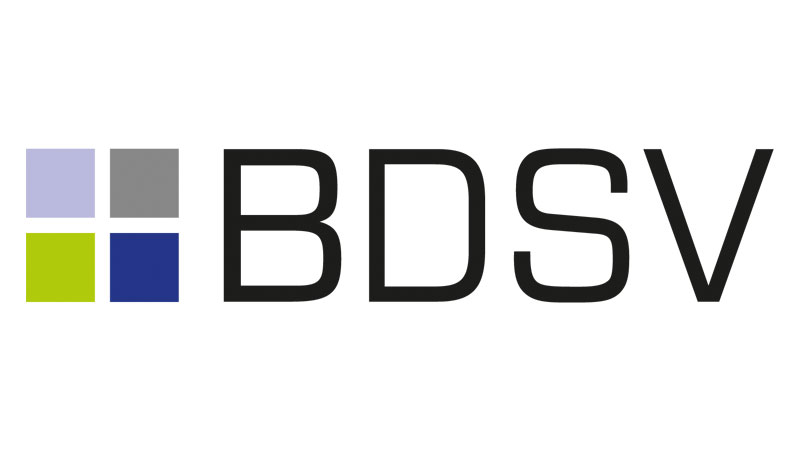Auf den ersten Blick ist Mehrweg ein analoges Thema: Becher, Schalen, Schüsseln – physische Gebinde, die gereinigt und wiederverwendet werden. Doch die entscheidende Innovation findet im Hintergrund statt – im Digitalen. Ein modernes Mehrwegsystem braucht heute mehr als nur Spülmaschinen und Pfandetiketten. Es braucht einen digitalen Zwilling.
Im Ansatz von Tomra erhält jedes Gebinde – sei es ein Kaffeebecher oder eine Salatschale – eine eindeutige digitale Identität. Diese ist in einer zentralen Datenbank gespeichert und wird bei jedem Rückgabe- und Reinigungsvorgang aktualisiert. Dadurch entsteht ein vollständiger digitaler Lebenslauf des Produkts: Wie oft wurde es genutzt? Wo wurde es ausgegeben? Wann wurde es gereinigt? Diese Rückverfolgbarkeit ermöglicht nicht nur Transparenz und Qualitätssicherung, sondern auch einen sicheren Umgang mit dem Pfandsystem.
Denn auch der Pfandprozess wird digital abgebildet. Der Pfandwert wird nach der Spülung, bei Auslieferung, bei der Ausgabe über einen Automaten oder eine Verkaufsstelle aktiviert und bei der Rückgabe wieder deaktiviert – ebenfalls automatisiert und fälschungssicher. Die Rückzahlung erfolgt kontaktlos über gängige Zahlungsmittel wie EC-Karte, Kreditkarte oder Apple Pay. Eine zusätzliche App oder eine Registrierung ist nicht erforderlich. Das System ist vollständig anonym und barrierefrei.
Durch die Digitalisierung werden Manipulationsmöglichkeiten ausgeschlossen, Prozesse beschleunigt und die Nutzung für Verbraucher*innen und Händler*innen vereinfacht. Der digitale Zwilling wird so zum Rückgrat eines zukunftsfähigen, skalierbaren Mehrwegsystems.
Wie Mehrwegsysteme konkret umgesetzt werden
Drei sehr unterschiedliche Pilotprojekte von Tomra – in Aarhus (Dänemark), Berlin (Deutschland) und Lissabon (Portugal) – zeigen, wie sich digitale Rücknahmesysteme unter verschiedenen Voraussetzungen etablieren lassen. Die Ansätze variieren, die Herausforderungen auch – doch sie geben wichtige Einblicke in die Realisierbarkeit und Skalierbarkeit moderner Mehrweglösungen.
Im dänischen Aarhus hat die Kommune selbst die Initiative ergriffen. Ohne gesetzliche Verpflichtung wurde ein öffentliches Mehrwegsystem ausgeschrieben, aufgebaut und gemeinsam mit Gastronomiebetrieben umgesetzt. Die Stadt investierte in eine Infrastruktur mit 27 rund um die Uhr zugänglichen Rücknahmeautomaten im öffentlichen Raum sowie einer dahinterliegenden Logistik- und Spülkette. Insgesamt beteiligen sich 55 Cafés, Restaurants, Kantinen und Street-Food-Märkte an dem System. Ziel war ein barrierefreies, komfortables System, das vollständig ohne App oder Nutzerregistrierung funktioniert. Das Ergebnis: 86 Prozent Rücklaufquote nach zwölf Monaten, über 30 Umläufe pro Becher – bei gleichzeitig wachsendem Vertrauen der Bevölkerung und einem guten Zusammenspiel zwischen Stadt, Gastronomie und Technologieanbieter.
Ganz anders ist die Ausgangslage in Berlin. Dort wird das System von der Deutschen Umwelthilfe und Rewe als Pilotprojekt vorangetrieben. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie vorhandene Infrastrukturen – wie Rücknahmeautomaten in Supermärkten und bestehende Logistikprozesse – für Mehrweg nutzbar gemacht werden können. In Berlin entstehen täglich rund 2 Millionen Einwegverpackungen im To-go-Bereich – ein enormes Abfallvolumen, das zeigt, wie dringend praktikable Lösungen gebraucht werden. Auch hier geht es um Bequemlichkeit: Wer seine Mehrwegverpackung wie eine Pfandflasche im Supermarkt abgeben kann, ist eher bereit, sie auch tatsächlich zurückzubringen. In einem Land wie Deutschland, wo Pfandrückgabe fest im Konsumverhalten verankert ist, liegt in dieser Schnittstelle großes Potenzial.
In Lissabon zeigen sich die Grenzen guter Absichten: Zwar existieren dort starke gesetzliche Rahmenbedingungen – etwa ein Verbot von Einwegplastik und eine klare Regulierung, was überhaupt als „Mehrweg“ gelten darf. Doch es fehlt an Kontrollen und Durchsetzung. Die Gastronomie ignoriert die Vorgaben oft, Mehrwegbecher landen im Müll oder auf der Straße. Jede Nacht werden in der Stadt rund 25.000 Becher konsumiert – bislang ohne funktionierende Rücknahmeinfrastruktur. Erst durch das gezielte Eingreifen von Dienstleistern wie Tomra – inklusive digitaler Erfassung, Rücknahmestellen und Reinigung – beginnt sich das System zu etablieren. Die Lehre: Ohne Umsetzung bleibt jede Regulierung wirkungslos.
Diese drei Fallbeispiele machen deutlich: Der Erfolg hängt nicht nur von der Technologie ab, sondern vor allem von den lokalen Rahmenbedingungen, der Rolle der Stadt oder Wirtschaft – und dem Willen zur Veränderung.
Was Mehrwegsysteme wirklich brauchen
Ob ein Mehrwegsystem funktioniert, entscheidet sich nicht allein an der Technik oder der Umweltmotivation der Verbraucher*innen. Es sind vor allem strukturelle und systemische Faktoren, die über Erfolg oder Scheitern entscheiden. Drei zentrale Aspekte haben sich in der Praxis als entscheidend herausgestellt: gesetzliche Rahmenbedingungen, die Rolle der Kommunen – und das Überwinden der „Bequemlichkeitslücke“.
Der Mensch wählt in aller Regel den Weg des geringsten Widerstands. Und genau hier setzt Regulierung an: Wenn Einweg teurer oder schlicht verboten ist, entstehen ganz automatisch Anreize, Mehrweg zu nutzen. Das zeigt sich am Beispiel der Niederlande, wo die Verwendung von Einwegverpackungen beim Verzehr vor Ort in Restaurants gesetzlich untersagt ist. Die Folge: Eine deutlich messbare Mehrwegquote – ohne langwierige Sensibilisierungskampagnen.
Gerade auf lokaler Ebene können Städte viel bewegen – vorausgesetzt, sie wollen es. Aarhus hat es vorgemacht: Die Kommune baute eine eigene Mehrweginfrastruktur auf, anstatt auf gesetzliche Vorgaben zu warten. Auch in Deutschland eröffnen erste Städte durch die Einführung kommunaler Einwegverpackungssteuern Spielräume. Wenn diese Gelder gezielt in Rücknahme- und Reinigungssysteme investiert werden, können daraus dauerhafte Mehrwegangebote entstehen, die sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch sinnvoll sind. Allerdings sieht Hennebach gerade in Deutschland sehr starke Beharrungstendenzen.
Der wohl größte Stolperstein in der Praxis ist die Rückgabe: Wer unterwegs einen Mehrwegbecher nutzt, muss ihn irgendwo zurückgeben können – und zwar ohne Umstände. Genau hier scheitern viele bestehende Systeme. Erfolgreiche Ansätze kombinieren deshalb Rückgabeautomaten im öffentlichen Raum mit der Rückgabe im Supermarkt, also Orten, an denen bereits gelerntes Verhalten existiert. Der Rückgabeprozess muss schnell, intuitiv und verlässlich funktionieren – nur dann greifen Menschen im Alltag wirklich zur Mehrwegverpackung.
Diese Faktoren zeigen: Technologische Lösungen sind notwendig, aber nicht ausreichend. Erst durch regulatorische Klarheit, kommunales Engagement und konsequente Nutzerorientierung entsteht ein System, das nicht nur denkbar, sondern auch machbar ist. Und dann spielt der Faktor Mensch keine wesentliche Rolle mehr, wie Hennebach betont.
Wo es (noch) hakt
So überzeugend die Pilotprojekte und technologischen Lösungen auch sind – die breite Umsetzung eines funktionierenden Mehrwegsystems steht vor mehreren Hürden. Einige davon sind technischer Natur, die meisten jedoch systemisch oder politisch bedingt. Wer Mehrweg skalieren will, muss sich mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen.
Eines der zentralen Probleme: In vielen Ländern existieren zwar ambitionierte Vorgaben – doch diese werden nicht durchgesetzt. Portugal ist ein Paradebeispiel. Dort gilt ein Einwegverbot in bestimmten Bereichen, und es gibt klare Kriterien, was überhaupt als „Mehrweg“ gelten darf. Dennoch ignoriert ein großer Teil der Gastronomiebetriebe die Vorgaben – ohne Konsequenzen. Solange gesetzliche Regeln nicht überprüft und Verstöße nicht sanktioniert werden, entsteht kein echter Veränderungsdruck.
Auch wenn lokale Initiativen oft als Impulsgeber fungieren, erzeugen sie auf Dauer eine hohe Komplexität – insbesondere für überregional tätige Unternehmen. Unterschiedliche Regelungen in verschiedenen Städten oder Bundesländern (etwa bei Einwegsteuern) führen zu bürokratischem Mehraufwand und erschweren eine einheitliche Logistik. Gerade die großen Systemgastronomen oder Handelsketten fordern daher zunehmend einheitliche Standards – nicht aus Prinzip, sondern aus ökonomischer Notwendigkeit.
Ein weiteres Hindernis liegt in den bestehenden Geschäftsmodellen. Im aktuellen Einwegsystem profitieren viele Akteure von der Marktdynamik – auch wenn das zulasten von Umwelt und Kommunen geht. Beispiel PET-Flaschen: Obwohl in Deutschland eine sehr hohe Sammelquote erreicht wird, liegt die tatsächliche Recyclingquote deutlich niedriger. Grund ist unter anderem, dass die gesammelten Materialien nicht zwingend in den Recyclingkreislauf zurückgeführt, sondern oft anderweitig – etwa für Rucksäcke oder Textilien – vermarktet werden. Das klingt grün, ist aber ökologisch problematisch, weil es den Kreislauf unterbricht.
Auch im Bereich der Mehrwegverpackungen ist das Recycling noch nicht zu Ende gedacht. Zwar bestehen viele Becher und Schalen aus hochwertigem Kunststoff wie Polypropylen (PP), doch bislang existieren keine geschlossenen Stoffkreisläufe für diese Materialien im Bereich lebensmitteltauglicher Anwendungen. Erst wenn der Rückfluss alter, unbrauchbar gewordener Gebinde technisch und regulatorisch abgesichert ist, kann von einem echten Kreislaufsystem gesprochen werden.
Der Weg zu einem flächendeckenden Mehrwegsystem ist also weniger eine Frage des technologischen Könnens, sondern vielmehr eine des politischen Wollens, der Marktdesigns und der Systemarchitektur.
Was jetzt getan werden muss
Die kommenden Jahre werden entscheidend dafür sein, ob sich Mehrwegsysteme von der Nische zur Norm entwickeln. Sowohl technologisch als auch regulatorisch zeichnen sich Entwicklungen ab, die das Potenzial haben, den Wandel zu beschleunigen – oder ihn massiv auszubremsen.
Die technologische Grundlage für skalierbare Mehrwegsysteme ist vorhanden – und entwickelt sich stetig weiter. Automaten werden schneller, zuverlässiger und kompakter. Die Integration in bestehende Infrastrukturen wie Supermärkte oder Hochschulcampus ist längst Realität. Gleichzeitig ermöglicht die Digitalisierung nicht nur komfortable Rückgabeprozesse, sondern auch eine lückenlose Nachverfolgbarkeit der Gebinde über den gesamten Lebenszyklus hinweg – ein entscheidendes Kriterium für Qualitätssicherung, Logistikoptimierung und regulatorische Nachweise.
Mit zunehmender Menge und Nutzung wird auch die Entwicklung effizienter Recyclingverfahren für Mehrwegmaterialien wie Polypropylen (PP) an Relevanz gewinnen. Sobald diese Prozesse standardisiert und zugelassen sind, wird die ökologische Bilanz noch einmal deutlich verbessert.
Regulatorisch gibt es zwei wirksame Stellschrauben: die Einwegverpackungssteuer und das Einwegverbot. Beide erzeugen wirtschaftliche Anreize bzw. Zwänge, Mehrweg überhaupt erst attraktiv zu machen. Doch es kommt auf die Ausgestaltung an. Eine Steuer, deren Einnahmen im allgemeinen Haushalt versickern, erzeugt bestenfalls Frust – aber keinen Wandel. Nur wenn diese Mittel zweckgebunden in den Aufbau einer öffentlichen Mehrweginfrastruktur fließen, kann ein echter Systemwechsel gelingen.
Vieles spricht auch für klarere gesetzliche Verbote, wie sie etwa in den Niederlanden eingeführt wurden. Die Wirkung ist unmittelbar: Unternehmen passen sich an, Dienstleister springen ein, neue Geschäftsmodelle entstehen. Statt endloser Diskussionen entsteht ein klarer Rahmen, in dem Innovationen gedeihen können.
Auf europäischer Ebene wird aktuell viel harmonisiert – nicht immer zum Vorteil der Umsetzung. Dabei betont Hennebach, dass eine gewisse Vielfalt nationaler Lösungen nicht nur zu verkraften, sondern sogar wünschenswert ist. Sie erlaubt es, in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Modelle zu testen, Erfahrungen zu sammeln und daraus zu lernen. Erst im zweiten Schritt – wenn erfolgreiche Ansätze sichtbar und erprobt sind – kann über eine sinnvolle Vereinheitlichung nachgedacht werden.
Ob Verbote, Anreize oder Infrastrukturausbau – entscheidend ist der politische Wille, Mehrweg nicht länger als freiwillige Option, sondern als notwendige Zukunftslösung zu behandeln. Der Markt reagiert schnell, wenn die Richtung stimmt. Die Technologien sind bereit. Die Menschen werden folgen – wenn man es ihnen einfach macht.
Man muss es wollen
Mehrweg ist möglich. Die Technologie ist vorhanden, die Praxisbeispiele sind überzeugend, das Nutzerverhalten lässt sich anpassen – sofern die Rahmenbedingungen stimmen. Was bislang vielerorts fehlt, ist nicht das Wissen oder die Machbarkeit, sondern der entschlossene politische Wille zur Umsetzung.
Erfolgreiche Mehrwegsysteme entstehen dort, wo klare Ziele formuliert, konsequent reguliert und infrastrukturelle Hürden aktiv beseitigt werden. Städte wie Aarhus, die mutig vorangehen, zeigen, wie Rücknahmeautomaten im öffentlichen Raum und digitale Prozesse zu funktionierenden Lösungen führen können. Ebenso deutlich wird: Regulierung muss nicht nur existieren, sie muss auch durchgesetzt werden – sonst bleibt sie folgenlos.
Ein funktionierendes Mehrwegsystem fällt nicht vom Himmel. Es braucht politische Klarheit, kommunale Initiative, unternehmerisches Engagement – und einen klaren Plan für die nächsten Schritte. Aber vor allem braucht es eines: den Willen zur Veränderung.